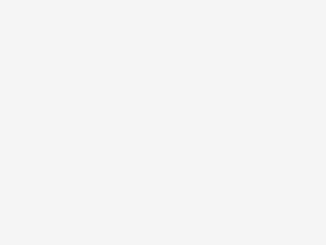Der Laden brummt, der Schweiß tropft, die Band rockt! Und doch außer Spesen nichts gewesen?
Im Unterschied zu Museen oder Theatern werden die über Live-Musikclubs nicht zur Hochkultur sondern eher zur Unterhaltungsbranche gezählt. Über den kulturellen Anspruch kann man sicher und immer streiten. Nicht aber, dass diese meist privat wirtschaftenden und daher ungeförderten Liveclubs die Konzerte im Grunde selbst bezuschussen. Nämlich durch die Gastronomie. Woran mag das liegen?
Im Grunde eine Rechengeschichte. Beleuchten wir es mal aus Sicht eines Clubs. Ein Club also mit Kapazitäten für sagen wir mal 100 Leute – also ein recht kleiner. Er hat eine gute Akkustik und macht sich zu eigen, ausschließlich Singer- und Songwriter-Club sein zu wollen. Große Technik braucht er also nicht, wohl aber eine Verstärkung für Gesang und Ansagen. Den können die Musiker selbst einstellen, technisches Personal ist also nicht nötig.
Nehmen wir an, dieser Club nimmt dafür 10,- € Eintritt. Mehr würden die meisten Leute wohl auch nicht für einen singenden Gitarrenschläger zahlen wollen. Der Laden wird halb voll, er hat also bei vollem Eintritt (meist wird nach Konzertbeginn der Eintritt aber leicht reduziert) 50 Tickets à 10,- € verkauft. 500,- € Einnahme. Klingt erstmal gut.
Davon gehen nun ab: Mehrwertsteuer, Werbung (Druck von Flyern, Plakaten, evtl. noch jemand, der es aufhängt oder austeilt), ein Grafiker, der den Monatsflyer erstellt, 4-5 % Künstlersozialkassenabgabe, weil es ein kreativer Job ist. Die Urheberrechtsvereinigung GEMA nimmt anteilig auf den Gesamteintritt 5%. Für die Abendkasse braucht es Personal. Und dann die liebe Verwaltunsgarbeit, denn Ordnung muß sein. Der Künstler muß eine Liste mit seinen gespielten Songs fertigen und von wem sie sind. Die müssen bei der GEMA nachgereicht werden. Die Anmeldung, dass es überhaupt ein Konzert geben wird und was es kostet, muß zuvor gemacht werden. Meist bedarf es auch eines Rahmenvertrages bei regelmäßigen Konzerten. Formulare, Formulare, Formulare …
Das Konzert samt Bild und Text muß an die Presse raus gegeben und am besten im eigenen Internetauftritt beworben werden. Der Musiker bekommt Freigetränke und vielleicht eine Kleinigkeit als Snack. Das muß buchhalterisch erfasst sein. Wenn es ein lokaler und “befreundeter” Musiker ist, wird man ihm vielleicht als Solisten 150,-€ Gage zahlen. Davon muß dieser noch seine Fahrtkosten, seine Arbeit, um den Gig zu bekommen und seine künstlerische Arbeit von konkret 4 Stunden (Aufbau, Soundcheck, Warten, zwei Konzertblöcke zu je 45,- € Minuten, Fahrtzeit und –kosten) bestreiten. Und so bleibt weder auf der einen, noch auf der anderen Seite Nennenswertes hängen.
Wäre der Club nun größer, werden auch die Kosten und Risiken höher. Mehr und bekanntere Musiker, wohlmöglich mit ansprechender Ton- und Lichttechnik, eventuell bekommt noch ein Agent für die Vermittlung der Band Geld, Hotel für auswärtige Künstler … Die Liste der Kosten könnte stetig weitergeführt werden. Eine Garantie, dass der Club voll wird, gibt es hingegen nie.
Was am Abend oft ein Spaß ist, verdeckt allzuoft die viele Arbeit und das hohe Risiko der kleinen Bühnen. Und selbst wenn der Club keinen Eintritt nimmt und ein Hut für Spenden rumgeht: der Kostenapparat bleibt in Teilen bestehen. Ohne Eintritt heißt nicht ohne Kosten!
Das Bier bezahlt die Band
Bezahlt wird die Musik letztlich durch Gewinne in der Gastronomie! Bier zahlt Band könnte man auch sagen. Das erklärt sich zuweilen auch aus der Geschichte von Live-Musikclubs. Denn früher engagierten Wirtshäuser durchaus Kapellen, um den Bierumsatz zu steigern. Sogenannte Brauhaus-Kapellen waren bis in die sechziger Jahre eben das Wochenende-Vergnügen. In all den Jahren hat sich aber nicht nur die Musik geändert. Vor allem sind hunderte Bestimmungen und Vorschriften entstanden, die das musikalische “Geschäft” immer weiter erschwerten. Die Unterstellung, dass das Wirtshaus aber eben nur aus Gewinnabsicht die Kapelle bestellt, ist oft noch geblieben.
Und hier beißt sich die Club-Katze in den eigenen Schwanz: der Eintritt darf nicht zu hoch sein, um möglichst viele Gäste anzulocken. Und die müssen nun wiederum möglichst viel konsumieren. Ruhige Konzerte (Klassik, Jazz, Experimentelles) heißt meist, konzentriertes Publikum und weniger Konsum. Und mal ehrlich: trinken Sie mehr als drei oder vier 3 Bier, Wein, Wasser? Der Markt bestimmt also ein wenig auch den Preis und auch die Musik.
Live-Musik ist so fast immer ein Zuschussgeschäft. Und die Quersubventionierung erfolgt durch die Gastronomie. Und damit nicht genug. Meist müssen Parties und Vermietungen allein deshalb gemacht werden, um die Live-Konzerte zu kompensieren.
Auch selbst wenn das nun alles läuft und leidenschaftliches Können im Hintergrund viele schöne Konzertabende beschert: das Ende der Fahnenstange ist es immer noch nicht. Konzession, Lärmschutz, Stellplatzabgabe, Spielstättenverordnung, Brandschutz, Sanitäranlage … ein einziger Nachbar kann einem Club das Leben zur Hölle machen! Karsten Schölermann, Betreiber des nun 40 Jahren “Knust”und auch im Harburger “Stellwerk “involviert, nennt es nicht zufällig die “Liste des Grauens”.
Und die Dimensionen in einer Metropole wie Hamburg sind immens. Seit einigen Jahren gibt es einen Fonds (“Live Concert Account” – kurz: LCA – genannt), der diesen immerhin mehr als 80 privaten und ungeförderten Musikclubs zumindest die bezahlten GEMA-Rechnungen des Vorjahres ausgleicht. Und das macht für ein Jahr allein in diesem einen Kostenpunkt mehr als 170.000,- €! Man ahnt hier aber auch, welche Wirtschaftskraft in den vermeintlich kleinen Clubs steckt.
Aber wo gibt es Lösungen? Immerhin: Politisch wurde auf Hamburger Ebene aber auch den meisten anderen Städten erkannt, dass eben Live-Clubs nicht nur zu vernachlässigende Subkultur sind, sondern zu einem guten Teil auch zur Attraktivität einer Stadt und ihrem Kulturleben beitragen. Schwieriger wird es aber zunehmend Anwohner und Clubs zusammen zu halten. Debatten über sogenannte “Kulturzonen”, in denen Anwohner eben akzeptieren müssen, dass Clubs abends auch mal laut werden könnten, gab und gibt es immer wieder. Einen Durchbruch aber nicht.
Viele Clubs sind auch wegen geringer Mietpreise oft in alten, heruntergekommenen Räumen. Das macht gesetzliche Anforderungen ebenso schwerig wie es aber bei steigenden Grundstücks- und Mietpreisen solche Räume zugleich immer weniger gibt. Und es ist Fakt, dass Clubs selten mehr als 5,- € Miete je Quadratmeter erwirtschaften können. Kredite bei Banken bekommen sie in den seltensten Fällen, Rücklagen sind bei den Margen kaum möglich.
Und wenn nun der Gast auch noch sein Bier vor der Tür am benachbarten Kiosk trinkt (“cornern”) oder gar selbst reinschmuggelt, sich über die Eintrittspreise beschwert oder gar Konzerte umsonst fordert, dann ist der Wert dieser Kultur bedroht.
Ein Wirt aus dem Süderelbe-Raum, der immer mal Musiker spielen ließ, kann hier stellvertretend zitiert werden: “Wir stellen das ganze Thema Livemusik ab nächstem Jahr ein. Da die Kosten zu hoch und das Interesse zu niedrig war in den letzten Jahren.”
Eine weitere Debatte ware vermutlich nötig, um die Kosten zu senken. Musikclubs könnten zum Beispiel steuerrechtlich ähnlich den Gastronomen gestellt werden, die Theater- oder Open-Gäste in der Pause bewirten. Die haben nämlich in ihren Getränkepreisen nur eine verminderte Mehrwertsteuer von 7 statt 19% einzukalkulieren. Bei einem Bier für 3,- € immerhin 33 Cent! Das ware eine Entlastung, die zumindest in Teilen den Kulturbetrieb erleichtern würde.
Kurzum: trinken Sie im Club Ihres Vertrauens demnächst ruhig mal ein Bier oder Wein mehr. Die Band wird es danken!
(21. Jan. 2017, hl)